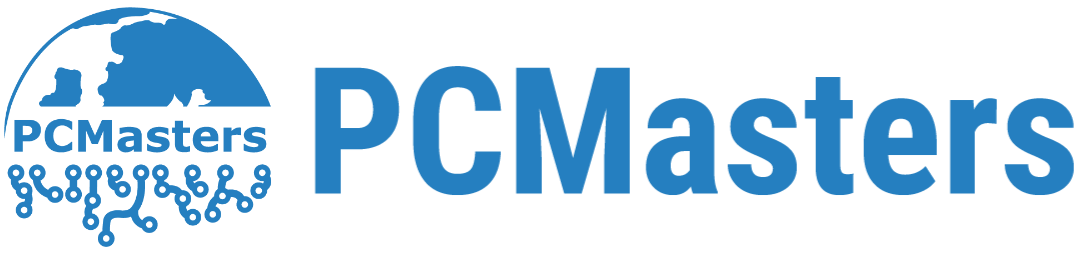iPhone 17 Pro Smartphone (Bild © Apple)
iPhone 17 Pro Smartphone (Bild © Apple)
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht eine Verfahrensfrage zum Zeitdruck. Die Ratspräsidentschaft hat die Idee verbreitet, dass das Europäische Parlament den aktuellen freiwilligen Rahmen für das Scannen von Plattformen nicht über April 2026 hinaus verlängern wird, wenn die Mitgliedstaaten nicht jetzt ein obligatorisches System genehmigen. Breyer sagt, dass es so eine Entscheidung des Parlaments nicht gibt: Es gab keine Beratungen, keinen Kompromiss und keinen Gesetzentwurf, um die aktuellen Regeln zu verlängern oder zu ersetzen. Seiner Meinung nach wird das Gefühl der Dringlichkeit künstlich erzeugt, um die Zustimmung für einen viel umfassenderen Überwachungsrahmen zu bekommen.
Das Argument des Zeitpunkts wird auch aus praktischen Gründen angezweifelt. Selbst wenn sich eine Mehrheit im Rat findet, würden die üblichen Trilog-Verhandlungen mit dem Parlament und die anschließende technische Umsetzung das Inkrafttreten über April 2026 hinaus verzögern. Das würde die behauptete Notwendigkeit untergraben, die Angelegenheit sofort zu regeln, um eine Compliance-Lücke zu vermeiden.
Deutsche Koalition uneinig über Scan-Mandat
Der Konflikt kommt zu einer Zeit, in der die deutsche Koalition mit ihrer eigenen Spaltung zu kämpfen hat. Das Justizministerium unter Führung der SPD lehnt das obligatorische Scannen von Chats aus grundrechtlichen Gründen ab und beruft sich dabei auf den Schutz vertraulicher Kommunikation. Das Innenministerium unter Führung der CSU drängt auf einen Kompromiss, damit Deutschland die Linie des Rates unterstützen kann. Es beruft sich dabei auf das Risiko, dass die Übergangsregelung mit freiwilliger Beteiligung ausläuft, eine Behauptung, die Breyer angesichts des Gesetzgebungskalenders und des Fehlens eines Mandats des Parlaments zur Beendigung der derzeitigen Regelung als irreführend bezeichnet.
Hohe Risiken, niedrige Schwellenwerte und Datenübermittlung
Kritiker des Verordnungsentwurfs sagen, dass Scan-Anordnungen nicht auf echte „Notfälle” beschränkt wären. Sie meinen, die Schwellenwerte seien so niedrig, dass große Kommunikationsplattformen dazu aufgefordert werden könnten, riesige Mengen privater Nachrichten zu scannen. Wenn ein automatisiertes System Material markiert, wird möglicherweise nicht nur der erkannte Inhalt weitergeleitet. Der Vorschlag sieht vor, dass umfassendere Chat-Verläufe an eine neue EU-Behörde und die nationale Polizei weitergeleitet werden, wodurch die Offenlegung über den ursprünglich markierten Inhalt hinausgeht.
Keine Zuverlässigkeit und Fehlalarme
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Genauigkeit. Gegner verweisen auf Erfahrungen aus der Praxis, wo automatisierte Systeme zur Erkennung illegaler Bilder große Fehlalarmquoten, angeblich im Bereich von 50 bis 75 %, verursacht haben, was die Gefahr erhöht, dass eine große Anzahl von Nutzern fälschlicherweise gemeldet wird. Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft warnen davor, dass umfassende Erkennungsmandate die Ermittler mit falschen Warnmeldungen überfordern, die freie Meinungsäußerung einschränken und die sichere Verschlüsselung gefährden könnten.
Ausnahmen für staatliche Akteure stehen im Fokus
Der aktuelle Entwurf in Artikel 7 würde die Kommunikation von Polizei, Militär, Nachrichtendiensten und den für diese Dienste zuständigen Ministern von Scan-Anordnungen ausnehmen. Kritiker sagen, dass diese Ausnahme ein zweigleisiges System schafft, das den Staat schützt, während Bürger und Unternehmen aufdringlichen Kontrollen unterzogen werden, obwohl es gemeinsame Cybersicherheitsanforderungen für vertrauliche Kanäle gibt, auch für Opfer, die geschützte Räume für die Kommunikation suchen.
Mobilisierung vor dem 14. Oktober
Angesichts der bevorstehenden Abstimmung im Rat fordern Aktivisten die Öffentlichkeit auf, sich zu engagieren und sich direkt an die nationalen Ministerien zu wenden, um sich gegen das zu wehren, was sie als massenhaftes, verdachtsunabhängiges Scannen privater Nachrichten bezeichnen. Sie stellen den Vorschlag als grundlegende Änderung der europäischen Tradition vertraulicher Korrespondenz und sicherer End-to-End-Verschlüsselung dar und warnen vor systemischen Risiken durch algorithmische Fehler und übermäßige Datenerfassung.